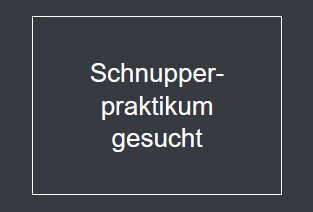„Wir können uns das Abenteuer der Alleinherrschaft nicht mehr leisten“ – das Risiko ist zu groß!“
Die menschliche Existenz ist durch Machtmenschen bedroht – so scheint uns der Blick auf die Geschichte zu lehren – und die Menschheit ist fähig aus diesen Erfahrungen zu lernen? Diese Frage ist es, der das P-Seminar unter der Leitung von Martin Stübinger mit der Aufführung des Stücks von Max Frisch „Die chinesische Mauer“ nachgeht – und die vielleicht, so mutmaßt der einführende Begrüßungsredner, Dr. Schlauch, einen wohl weniger unterhaltsamen als viel mehr lehrreichen Abend verspricht. Wird er mit seiner Vermutung recht behalten?
Als Zuschauer ist man gespannt, was einen erwartet, denn das professionell gestaltet Programmheft, für das sich Gina Rose Cotton verantwortlich zeichnet, spricht – ebenso wie das von Johanna Gerike professionell stilisierte Plakat - von dem Stück als Farce, in welchem berühmte Masken der Vergangenheit zu einem Schauprozess des chinesischen Despoten, Kaiser Hwang Ti, geladen werden, um zuzusehen, wie dieser versucht, die Stimme des Volkes, verkörpert durch einen einfachen chinesischen Bauern, mundtot zu machen. Das dürfte sicherlich ganz im Sinne der vielen historischen Persönlichkeiten sein, die auftauchen, um dem Ereignis beizuwohnen.
Da in diesem Stück die Zeitdimensionen aufgehoben sind, verwundert es auch nicht, dass zunächst ein Heutiger zu mysteriösen chinesischen Klängen, live dargeboten auf dem Marimbaphon von Sinan Graf auftaucht und den Zuschauer in die Geschehnisse in China – zur Zeit des Baus der Großen Mauer – einweist. Jonathan Wiegandt gibt den allwissenden Heutigen überzeugend intellektuell, mit klarem Sprachduktus, souverän selbstsicher und am Ende dann doch an der Realität verzweifelnd. Doch noch ist die Stimme des Volkes, nach der vom chinesischen Kaiser im ganzen Land verzweifelt gesucht wird, nicht gefunden, wie chinesische Mutter verkündet, die sich mit ihrem Sohn auf dem Weg zum Kaiser, „dem Himmelssohn, der immer im Recht ist“, befindet. Emily Weiß spielt die chinesische Mutter in einer Mischung aus Freude und Hoffnung, mit kleinen Schritten auf die Bühne trippelnd, im Schlepptau ihren Sohn, der – wie am ausdrucksstarken Spiel von Johanna Losgar schnell klar wird – stumm ist. Und schon ziehen die beiden geschundenen Wesen weiter – in der Hoffnung einen Blick auf den ach so großen, gepriesenen Kaiser zu erheischen.
Szenenwechsel – der bisher geschlossene Vorhang öffnet sich – man erblickt einen Ausschnitte einer aus gigantischen grauen Blöcken gebildeten Mauer – daneben einen auf einem roten Podest erhobenen Thron, der über alles ragt. Überhaupt sind Bühnenbild und Kostüme, Requisiten und Masken auf faszinierende Weise bis ins letzte Detail durchchoreographiert – die Farben des Abends bleiben rot, schwarz und weiß – die Vertreter des chinesischen Volkes sind eindrucksvoll mit rotem Augen-Makeup gekennzeichnet (den versierten Macherinnen von Make-Up und Kostüm, Gina Rose Cotton und Kayla Silva-Bößert, sei Dank), die Masken der Vergangenheit tragen erkennbar nuancierte zeittypische Gewänder und tatsächlich weiße Masken. Der intellektuelle Heutige trägt Sakko, Hemd und Jeans, die Zigarette wird als lässiges Accessoire präsentiert – nichts wird dem Zufall überlassen – alles ist ins letzte Detail stimmig unterlegt - Licht und Tontechnik inklusive: die ganzen Szenen des Stücks werden durch das Technik-Team (Sebastian Losgar, Alwin Hellwich, Jonathan Wiegandt, Noah Kießling, Diana Weinbrecht und Johanna Losgar) gekonnt ausgeleuchtet und vertont. Es tragen aber auch live eingespielte Sound- und Musikpassagen (Victor Reichert und Sinan Graf) zur geheimnisvollen oder oftmals auch militärischen Atmosphäre der einzelnen Szenen bei.
Doch jetzt gerade ist es geheimnisvoll, wir befinden uns nämlich mit einem Mal auf dem Ball des chinesischen Kaisers, zu dem die Figuren der Vergangenheit nun nach und nach eintrudeln. Zunächst erscheinen Romeo und Julia. Das noch hoffnungsvolle Paar erinnert an das Wesen der Menschen: Liebe und Zuversicht schwingen in dem Auftritt der beiden mit (Lena Jendrysik verkörpert Julia auf schüchterne, keusche Weise; Viktor Reichert offenbart ihr mit seiner nachdenklichen Romeo-Darstellung Schutz). Doch ihre Liebesbezeugung wird von einer Stimme aus dem Off unterbrochen, die zur Polonaise auf der Terrasse einlädt, und mit einem Mal ist man mitten drin in der Farce dieses Maskenballs, der nun zu einer dynamisch-rhythmischen Musik im Stil einer modernen Polonaise alle Masken auf den Plan ruft und in ihren individualisierten Posen einfrieren lässt. Der Heutige, gleichfalls mit von der Partie wird im Folgenden mit der ein oder anderen Maske näher ins Gespräch kommen und sie auf ihre Bedeutung und ihre Ziele, ihre Fehler und die Lehren, die aus ihrer Existenz gezogen wurden, aufmerksam machen. Neben Napoleon (in typischer Pose sicher gespielt von Sinan Graf) tauchen da noch Columbus und Pontius Pilatus auf. Der eine ist immer noch entsetzt darüber, dass er nicht Amerika, sondern Indien entdeckt hat (Johanna Gerike stellt Columbus dabei stimmig als langsamen, dattrigen, alten Greis gestützt auf einem Gehstock dar), während Pontius Pilatus (engagiert zweifelnd von Christopher Schmidt präsentiert) über die Frage nach der Wahrheit sinniert. L‘Inconnue de la Seine ist es schließlich, die mit ihrer leichtfüßigen, beschwingten Art (überzeugend auch in dieser Rolle: Johanna Losgar) Stimmung auf die Party zaubert und alle mit Sekt versorgt, obwohl ihr eigenes Schicksal ja letztlich kein Grund zum Feiern sein dürfte – schwanger, an Tuberkulose erkrankt und zuletzt tot in der Seine gefunden – doch noch glauben wir ihr das nicht – Hoffnung flammt auf. Da gibt es ja auch noch den erbost dynamischen Brutus, der immerhin die Republik verteidigte. Eric Artes, der an diesem Abend sehr körperlich in ganz viele kleinere Rollen schlüpft (z.B. Ausrufer oder auch Scharfrichter des Kaisers) präsentiert diesen „Verteidiger der gerechten Sache“ – Mord an Caesar hin oder her - echauffiert und aufgeregt. Cleopatra kann diese Theatralik gar nicht verstehen – sie ist hier ganz Frau von Welt, die zielsicher das Umfeld der Macht sucht. Emily Weiß vermittelt auch hier durch klare Körpersprache die souveräne, unaufgeregte Haltung einer verführerischen Herrscherin. Was Verführungen angeht, kennt sich auch der nächste Gast aus: Don Juan. Viktor Reichert gibt auch diesen Helden, der betrübt darüber ist, dass sich die Nachwelt sich ihr ganz eigenes Bild von ihm gemacht hat, dynamisch und selbstbewusst. Ein Duktus, der auch den Weltenbeherrscher Philipp von Spanien umgibt, der von Tobias Steinhäuser ganz klar und sicher im Gestus, als streng religiöser Fanatiker präsentiert wird.
Als der Heutige von diesem „Gedankenfreiheit“ fordert, wird das Treiben scheinbar zu bunt, denn der Zeremonienmeister des Kaiser tritt auf den Plan und kündigt die Ankunft des „Himmelskönigs“ an. Christopher Schmidt leistet auch in dieser Rolle ganze körperliche Spannung und Präsenz, wird er doch in dieser Position immer wieder den Hunden vorgeworfen – und sehr körperlich von den Soldaten des Kaisers von der Bühne gezerrt – sowohl als Da Hing Yen I, Da hing Yen II, Da Hing Yen III und so weiter – man vermag dieses immer wiederkehrende Spiel als Zuschauer, nur zustimmend nickend, leider nicht als paradox, sondern eher als mitten aus der (stets wiederkehrenden) Geschichte entnommen zu empfinden.
Dabei ist am wiederkehrenden Tod des Zeremonienmeisters noch nicht einmal der Kaiser schuld – es ist vielmehr seine Tochter, Mee Lan, die diesen Befehl immer wieder ausspricht – wenngleich sie damit das Leben des Heutigen zu schützen scheint, mit dem sie ins Gespräch gekommen ist. Was zählt welches Menschenleben – und wieviel?
Zunächst erscheint Mee Lan in diesem Sammelsurium an Mächtigen und Despoten noch eine aufgeklärte Lichtgestalt zu sein. Im Gespräch mit der braven Kammerzofe Siu (glaubhaft dargestellt von Kayla Silva-Bößert) durchschaut sie das Spiel ihres Vaters, offenbart die Herrschaftsstrategien der Männer, „die immer vom Sieg sprechen“. Die wissbegierige, jugendlich-dynamische Tochter des Kaisers findet im Heutigen einen Gesprächspartner auf Augenhöhe und saugt das Wissen der Jetzt-Zeit mit jeder Faser ihres Körpers auf. Zsuzsanna Márki-Zay überzeugt in vollem Maße in ihrer Rolle als Mee Lan – Mimik und Gestik verdeutlichen glaubhaft deren Wissbegierde, das Unverständnis oder das Entsetzen über die Entwicklungen der Menschheit. Man fühlt mit, wenn sie amüsiert über die hüpfende Mondlandung der Menschen ist, sarkastisch ob der Dummheit ihres eigenen Vaters und wenn sie den Zustand der Entfremdung der Menschheit entsetzlich findet: „Ihr, die ihr alle erwachsen seid, schweigt!“ – Man glaubt an einen Menschen mit Herz und Gefühl. Schade nur, dass sie schon acht Liebhaber in den Krieg hat ziehen lassen, weil sie nicht lieben kann – und eben auch der ein oder andere Zeremonienmeister dran glauben muss. Und dies nur, weil der Zeremonienmeister die Reden des Heutigen nicht dulden kann – ist vielleicht der Heutige die aufrührerische Stimme des Volkes? Mee Lan wischt diese Zweifel weg - ab vor die Hunde mit dem Zeremonienmeister! Wann beginnt die Despotie?
Spätestens jetzt, wenn der so lang herbeigeredete Kaiser dann die Bühne betritt, um die Verhaftung „der Stimme des Volkes“ zu verkünden. Arvid Lumma stellt den Kaiser Hwang Ti, in roten Bademantel gehüllt, als eine Mischung aus überzeugtem Regenten sowie enttäuschtem, weil nicht so geliebt wie erwartetem Kind dar. Sein Gestus gleicht eher dem eines Privatmannes, der glaubt alles erreicht zu haben: „Die Welt ist frei!“ Ja, nur für wen? Kaiser Hwang Ti weiß die Zukunft zu verhindern, die chinesische Mauer ist das gigantische Zeichen seiner allumfassenden Macht, deren Kriege er locker lässig mit Playmobil-Männchen nachzeichnet: Menschen als Spielfiguren der Macht. Wie kann es sein, dass sich jemand anmaßt, seinen Ruhm („Es sind keine weiteren Siege mehr möglich!“) mit üblen Reden zu zerstören? Arvid schafft es, diese Rolle in vielen Facetten, mal laut tobend, mal weinerlich und dann doch wieder bestimmt auf die Bühne zu bringen.
Der Prinz Wu Tsian ist es, der den Kaiser über diesen Aufruhr des Volkes informiert. Er ist es, der das Spiel der Mächtigen gleichfalls durchschaut hat und wütend wird ob der leeren Versprechen (Ehe mit der Königstochter, Anwärter auf Nachfolge des Kaisers etc.), mit denen er hingehalten wird – auch von der Königstochter, die ihn, wie alle anderen Anwärter zuvor klar in seine Schranken weißt, jetzt, wo der spannendende Heutige aufgetaucht ist. Johanna Gerike spielt diesen männlichen Anwärter auf den Thron noch etwas zweifelnd, noch erscheint der Prinz zu sympathisch, als dass die Drohungen, die er ausspricht, um die Kaisertochter für sich zu gewinnen, überzeugend wirken. Der Kaiser ist jedenfalls verzweifelt über die Proteste im Volk bzw. die Stimme des Volkes – Moment, war verzweifelt, denn jetzt ist die Stimme des Volkes ja gefasst, der Prozess wird gemacht – nach der Pause.
Nach der Pause geht es dann nicht weniger konzentriert und vielschichtig weiter, denn der Prozess, der ganz klar als Farce entlarvt wird – ist die Stimme des Volkes doch der stumme Bauernsohn der chinesischen Mutter - wird von der engagierten Theatergruppe weiterhin äußerst fokussiert und scheinbar mühelos umgesetzt- und das, obwohl bereits eine Spielzeit von ca. 70 Minuten hinter der Truppe liegt – was man als Zuschauer gebannt von der tiefgründigen Vielfalt des Geschehens aber nicht zu glauben vermag. Es kommt wie es kommen muss, der Kaiser entlarvt sich letztlich durch seine Reden, mit denen er seine Leistungen präsentieren will, selbst – die Tochter Mee Lan scheint dennoch das einzige Wesen mit menschlichem Mitgefühl zu sein und zeigt sich enttäuscht vom Heutigen, der doch alles weiß – und doch nichts zu ändern vermag?
Und der Heutige, der bisher alles wissend kommentiert und reflektiert hat? Es gelingt Mee Lan doch tatsächlich ihn aus der Räson zu locken: in einem emotionalen Ausbruch wird die große Frage offenbar, die umtreibt – und deren Beantwortung heute – wie damals – so leicht nicht möglich erscheint: Was ändert die rationale Durchdringung des Weltgeschehens? Lässt sich Welt – lässt sich Mensch verändern? Lernen wir aus unserer Geschichte?
Der Stimme des Volkes vermögen diese emotionalen Fragen des Heutigen nicht zu helfen: in einer bedrückenden, szenisch-stilisierten Folterszene, in der Johanna Losgar ein beeindruckendes stummes Spiel gefolteter Menschlichkeit darstellt, scheint alle Hoffnung verloren. Die darauf folgende emotionale Reaktion der Mutter des Gefolterten geht unter die Haut – Trommelwirbel, Aufstand des Volkes, Ehrung des Heutigen durch den Kaiser, Machtübernahme durch den Prinzen als Führer des Volkes – STOPP: „Wir spielen nicht weiter, weil die ganze Farce von vorne beginnt.“
Waren es zuletzt die Masken Brutus oder „Frack & Cut“, die wie die Alten vom Balkon der Muppet-Show (Sinan Graf und Tobias Steinhäuser sind hier noch einmal passend präsent unterwegs) in die Szenerie eingreifen? Man weiß es am Ende gar nicht mehr – das Spiel der Masken setzt wieder ein – stilisiert, abstrus und unheimlich. Nur die Unschuld von Romeo und Julia, die noch einmal kurz zu Wort kommen dürfen – lassen trotz aller Hoffnungslosigkeit: „Ist denn kein Ort für unsrer Liebe Glück?“, gerade deswegen doch Hoffnung entstehen: „Oh Welt! Wir lieben dich; du sollst nicht untergehen.“
Die Vermutung des lehrreichen Theaterabends hat sich in vollem Maße erfüllt. Es hat sich aber auch gezeigt, dass die Vermittlung komplexer Menschheitsfragen auch auf anregend-konzentrierte, kurzweilige Weise erfolgen kann. Denn das bis in die letzte Haltung fokussiert spielende P-Seminar hat gezeigt, dass es gerade mit einer tiefgründigen, fokussierten Durchdringung des Stücks – Herr Stübinger sprach von schier unendlichen, fruchtbaren Diskussionen über Bedeutungen und Interpretation – in seinen Bann zu ziehen vermochte. Dies ist sicherlich nicht nur dem sehr engagierten P-Seminar, sondern auch dem im Hintergrund Strippen ziehenden Spielleiter zu verdanken. Über zwei Stunden Spielzeit waren zuletzt im Nu verflogen – und am Ende bleibt nach diesem intellektuellen Theaterabend viel beim Zuschauer hängen, eine Erkenntnis aber auf jeden Fall: „Wir können uns das Abenteuer der Alleinherrschaft nicht mehr leisten!“
T: A. Kießling
Fotos: V. Artes