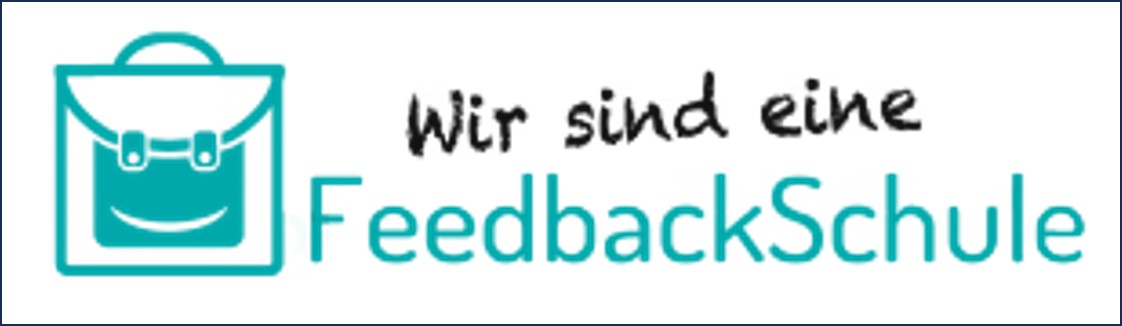Am Donnerstag vor Ostern (10. April 2025) wurden die zehnten Klassen des E.T.A. Hoffmann-Gymnasiums in der Universitätsklinik Erlangen von Oberärztin Dr. med. Katharina Heller, die im Erlangener Krankenhaus die Transplantationspatienten betreut, und ihrem Team empfangen.
Leben ohne Niere
Die Oberärztin stellte den Schülerinnen und Schülern zum Thema Organspende Stefan vor, der zu ihren Patienten gehört und dringend eine Spenderniere benötigt. Er selbst ist Fahrlehrer und hat eine chronische Niereninsuffizienz, eine Krankheit, bei der die Nieren ganz oder teilweise versagen, also nicht mehr richtig entgiften und den Harn aus dem Blut filtern. Diese Krankheit wurde bei Stefan im Alter von sieben Jahren festgestellt – jetzt ist er 36. Allerdings arbeiteten seine Nieren noch, wenn auch schwach. Und trotzdem bauten die Nieren kontinuierlich ab, sodass sie in seinem 20. Lebensjahr komplett ausfielen und er Dialysepatient wurde. 16 Jahre lang war er nun drei mal in der Woche bei der Dialyse, oft in der Nacht und bis zu 8 Stunden lang. „Hochleistungssport“ sei das, berichtete seine Ärztin. Ein weiteres Problem für Stefan ist die Menge an Flüssigkeit, die er am Tag zu sich nehmen darf. 1,5 Liter maximal und inklusive der Flüssigkeit, die im Essen enthalten ist, bereiten ihm, wie er erzählt, ständig Durst. Auch essen dürfe er nicht mehr alles, sagt Stefan, denn wenn die Entgiftung durch die Niere nicht mehr funktioniert, kann sich Kalium im Blut sammeln und Herzrhythmusstörungen verursachen. Einige Südfrüchte sind somit Tabu und auch normale Nahrung wie Kartoffeln muss der Patient um die zwölf Stunden wässern, bis das meist Kalium herausgekommen ist. Ebenfalls ein Problem: Einfach mal mit Freunden etwas trinken gehen funktioniert nicht mehr und auch Reisen wird schwierig. Trotz aller Hindernisse steht für Stefan, der stationär im Krankenhaus liegen muss, wahrscheinlich bald eine Transplantation an, meint die Ärztin hoffnungsvoll.
Organspende – ab wann ist sie möglich?
Zu diesem Thema berichtete Oberarzt Dr. Kosmas Macha, der selbst Neurologe und Transplantationsbeauftragter am Universitätsklinikum Erlangen ist, dass die postmortale Spende erst nach einem unumkehrbaren Hirnfunktionsausfall, auch als Hirntod bekannt, möglich ist. Der Hirntod gilt in Deutschland offiziell als Tod, allerdings nicht der Herztod, bei dem das Herz aufhören würde zu arbeiten. „Das komplette Hirn muss ausfallen, also Großhirn, Kleinhirn und Gehirnstamm“, erklärt der Neurologe und weiter: „Dies kann zum Beispiel bei Hirnblutungen vorliegen.“ Um den Hirntod festzustellen müssen zwei Fachärzte, die nicht bei der Organentnahme oder -verpflanzung dabei sein dürfen, unabhängig voneinander zum selben Urteil, dem Hirntod, kommen. Dabei werden, um den strengen Anforderungen für die Diagnostik nachzukommen, bei den Patienten unter anderem Reflexe getestet und Gehirnströme gemessen um den sicheren unumkehrbaren Hirntod feststellen zu können.
Wer kann Organspender werden und was kann gespendet werden?
Nach den Oberärzten betrat Kilian Weidner, der bei der Deutschen Stiftung Organtransplantation ein Koordinator ist, den Hörsaal. Er zeigte, dass sehr wenige Menschen Organe nach dem Tod spenden. So gab es im letzten Jahr in Bayern 158 Spender, das sind rund zehn Spender pro 1.000.000 Einwohnern. Trotzdem warten etwa 12.000 Menschen auf Organe, davon 8.000 auf eine Niere, berichtete er. Als Organspender muss in Deutschland zwangsläufig der Hirntod vorliegen, trotzdem ist die Todesursache meist egal. Kilian Weidner machte deutlich: „Es gibt auch keine Altersbeschränkung für die Organspende.“ Eine Einwilligung zu Lebzeiten oder eine der Angehörigen ist allerdings zwingend erforderlich. Er rät deshalb, um die Angehörigen in einer schweren Zeit nicht zusätzlich zu belasten, seinen Willen klarzumachen. Entweder mündlich oder mittels eines Organspendeausweises. Bei Zustimmung können dann Herz, Lunge, Leber, Bauchspeicheldrüse, Nieren und Gewebe wie Augengewebe entnommen werden.
Rechtliche Grundlagen
Caroline Jürgen vom Bayrischen Gesundheitsministerium klärte die Schülerinnen und Schüler über das Rechtliche beim Organe spenden auf. Sie zeigte, dass Deutschland bei einer Organspende nach dem Tod, anders wie zum Beispiel in Österreich nicht auf die Widerspruchslösung, sondern auf die erweiterte Zustimmungslösung gesetzt wird. Dabei muss man selbst oder die Angehörigen eine Organspende aktiv zustimmen. Dies ist ab 16 Jahren alleine möglich, ab 14 kann einer Organentnahme widersprochen werden. Bei der Widerspruchslösung hingegen müsste man aktiv „Nein“ zu einer Organspende sagen, weil grundsätzlich jeder für eine potentielle Organspende herangezogen werden könnte. Eine Lebendspende sei bisher jedoch nur bei einer engeren Beziehung zum Spender möglich, dies könnte jedoch bald reformiert werden, sagte Frau Jürgen.
Verpflanzung und aktueller Forschungsstand
Als nächster Referent kam der Herzchirurg Dr. med. Markus Kondruweit zu den Schülerinnen und Schülern, der zuerst die Lage und Bedeutung des Herzens als sehr wichtiges Organ veranschaulichte. Denn das Herz schlägt im gesamten Leben ca. 3,4 Milliarden mal. Der Arzt zeigte die Therapiemöglichkeiten am Beispiel von Herzschwäche und machte deutlich, dass ein Spenderherz, welches eine komplizierte und möglicherweise problematische OP nach sich zieht, das letzte Mittel der Wahl ist. Trotzdem wurde die erste Herzverpflanzung bereits im Jahr 1967 in Kapstadt erfolgreich durchgeführt. Wie die Herzverpflanzungen in Erlangen funktionieren zeigte und erklärte Dr. Kondruweit unter anderem an Bildern und Videos, die zu Demonstrationszwecken im Uniklinikum erstellt wurden, sehr anschaulich. Dabei war auch unter anderem ein schlagendes Herz in der Brust zu sehen, das nach einer Herzverpflanzung zu schlagen begann. Zu den Gründen, warum Menschen ein neues Herz brauchen, zählen unter anderem koronare Herzerkrankungen, die zum Beispiel durch Rauchen verursacht werden können. Dazu bemerkte Dr. Markus Kondruweit: „Raucher finanzieren den Laden hier.“, und weiter: „Rauchen ist Selbstmord auf Raten.“ Egal aus welchen Gründen, es brauchen viele Menschen ein menschliches Spenderherz. Doch wegen Organmangel, berichtet der Mediziner, könne man erst in der höchsten Dringlichkeitsstufe ein Herz bekommen. Mit diesen Eindrücken und einer Menge an neuem Wissen verließen die 10. Klassen Erlangen und den dortigen kleinen Kosmos der Universitätsklinik.
Bericht: Felix Berger, 10a
Bilder: Felix Berger
Gruppenbild: Johannes Müller